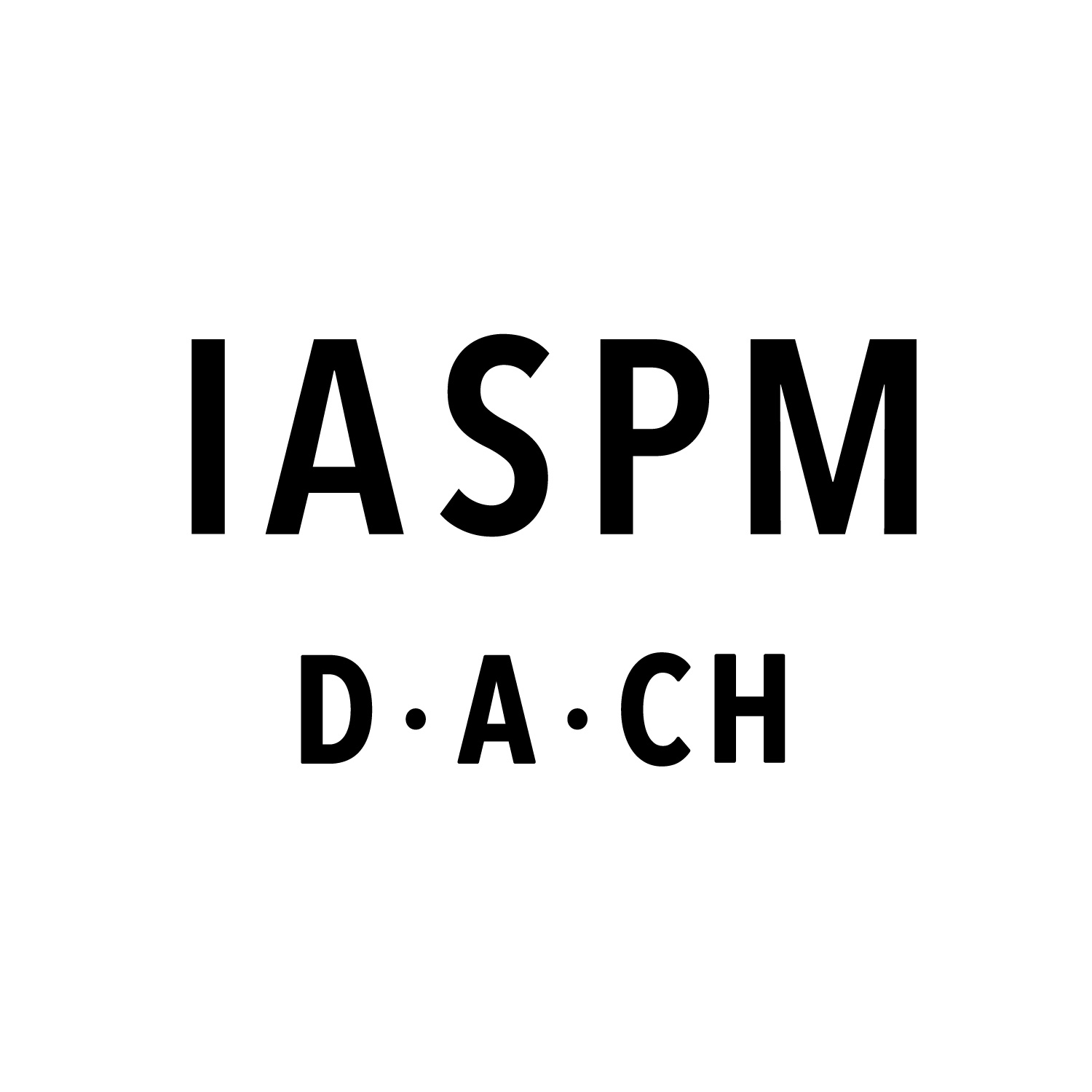CfP: Postmigrantische Musikgeschichte(n) (23.–24.03.2026, HfMT Köln) Deadline: 15.10.2025
Call for Papers
Postmigrantische Musikgeschichte(n): Performances von Imperialität, Nation und Heimat
Abschlusssymposium des Lehrprojekts »Kölner Musikgeschichten: Postmigrantische Kulturen erforschen, verorten und vernetzen« an der Hochschule für Musik und Tanz Köln
23. - 24. März 2026
Wie und wo klingen »Istanbul und Rom in Köln« und was hat das alles mit postmigrantischen Heimaten zu tun? Und warum denken wir ethnographische und historische Musikforschung nicht einfach mal zusammen? Türkische Musik in Köln hat seit 1961 Geschichte geschrieben, da Gastarbeiter an den Rhein kamen, aber sollten wir nicht auch osmanische Musiktraditionen kennen, um Kölner Musikgeschichten postmigrantischer türkischer Communities zu verstehen? Und hat nicht »Rom« eine noch viel längere Geschichte in Köln, das als römische Kolonie (»Colonia«) begründet wurde? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich das Lehrprojekt ‚Kölner Musikgeschichten: Postmigrantische Kulturen erforschen, verorten und vernetzen‘. Im Rahmen des Abschlusssymposiums möchten wir diese Thematik als Ausgangspunkt für gemeinsame Reflexionen nutzen. Inwiefern verweisen die Leitfragen unseres Projekts auf grundlegende gesellschaftliche Prozesse und Perspektiven? Wie begegnen wir methodisch der Komplexität postmigrantischer Musikgeschichten, die sich weder ausschließlich gegenwartsbezogenen noch rein historisch erschließen lassen? Wir sind offenbar herausgefordert, Erinnerung, Raum, kulturelle Imagination und Performanz zusammen zu denken. Das Symposium greift diese Verflechtungen auf und strukturiert sie in thematische Schwerpunkte, die unterschiedliche theoretische wie methodische Zugänge eröffnen.
Imaginäre Performativität
Einen ersten Schwerpunkt setzen wir auf »Imaginäre Performativität«. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, durch Akte, Diskurse oder Praktiken soziale Realitäten zu erschaffen. Diese imaginären Realitäten können aktualisiert, verkörpert oder/und materialisiert werden. Den Fokus möchten wir auf die Performativität von imaginären Nationen und Heimaten setzen. Deren Performances können sowohl durch affirmative Handlungen als auch durch Widerstände gegen etablierte Normen erfolgen — etwa durch klangliche, symbolische und performative Handlungen. Diese Praktiken kreieren neue Bedeutungen, sie tragen historische Kämpfe aus und gestalten kulturelle Imaginationen durch Performances neu. Uns interessiert insbesondere, solche Prozesse zu analysieren, in denen Räume für Verhandlungen und Selbstbehauptungen greifbar werden: Wir möchten Orte untersuchen, wo neue Bedeutungen für Erinnerungen und Imaginationen von Zugehörigkeiten und Identitäten in einer vielschichtigen, pluralen Gesellschaft gestaltet werden.
Strains of Urban Inter-Imperiality
Einen zweiten Schwerpunkt setzen wir auf das Motto »Strains of Urban InterImperiality«. Der Begriff »Inter-Imperialität« beschreibt die komplexen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Imperien — sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart — und deren Einfluss auf gesellschaftliche, politische und kulturelle Ordnungen. Er macht deutlich, dass Imperien nicht isoliert existieren, sondern sich in Konkurrenz-, Kooperations- und Konfliktbeziehungen zueinander befinden und dabei Räume, Machtverhältnisse und kulturelle Praktiken prägen. Städtische Räume werden dabei zu Schauplätzen, an denen sich interimperiale Dynamiken in Form von räumlichen Eingriffen, kulturellem Austausch und Machtkämpfen manifestieren. Urbanes Leben ist dabei häufig von Belastung (strain) geprägt. Städte sind Orte der Migration und der Begegnung – und damit Kristallisationspunkte vielfältiger sozialer und kultureller Spannungen. Als Knotenpunkte von Revolutionen, politischer Ökonomie und geopolitischer Macht werden Städte durch Spannungen des Protests, des Kampfes und imperialer Aggression geformt – und bewahren diese zugleich als Archive, aber auch als klangliche Räume. »Strain« verstehen wir als konzeptuelles Modell, um die dynamische Verflechtung von Klang, Erfahrung und dialektischem Konflikt im urbanen inter-imperialen Kontext zu beleuchten. Entsprechend vielfältige Ausdrucksformen und Auswirkungen dieser Verhältnisse auf historische wie gegenwärtige urbane Räume möchten wir untersuchen.
Auch wir im Feld! (Auto)ethnographische Methoden in der Musikgeschichtsforschung
Dem Motto »Auch wir im Feld!« folgend, möchten wir Erfahrungen, Zugänge und Perspektiven erkunden, die sich aus einer vertieften Zusammenarbeit zwischen ethnografischen und historischen Ansätzen ergeben. Wie können wir in der ethnologischen und historischen Musikforschung stärker voneinander lernen? Ist es nicht an der Zeit, ethnografische Methoden für die Musikgeschichtsschreibung fruchtbar zu machen? Uns selbstkritisch zu positionieren, eigene Vorerfahrungen offen zu reflektieren, wenn wir unsere Perspektiven auf Musikgeschichte entwickeln? Sollten wir nicht verstärkt gegenwärtige Bezüge zu historischen Quellen herstellen und ethnografische Felder erschließen, um historische Forschung deutlicher in der Gegenwart zu verankern? Und ist es nicht ebenso an der Zeit, die historische Tiefe ethnologischer Forschungen stärker in den Blick zu nehmen? Hier sind wir auch gespannt, Fallbeispiele gemeinsam zu diskutieren.
Musikwissenschaft(en): Grenzen, Spannungsfelder und produktive Reibungen
Neben den bereits genannten Themenschwerpunkten möchten wir im Rahmen dieses Symposiums auch eine vertiefte, kritische Auseinandersetzung mit disziplinären Grenzen, Spannungsfeldern und produktiven Reibungen zwischen unterschiedlichen musikwissenschaftlichen Subdisziplinen ermöglichen. Uns ist bewusst, dass gerade die Übergänge zwischen Fachrichtungen oftmals Reibungspunkte darstellen, die jedoch zugleich das Potenzial für kreative Impulse, methodische Erweiterungen und neue Perspektiven in der Forschung bieten. In diesem offenen Forum bzw. Workshop möchten wir gezielt zum interdisziplinären Dialog einladen. Besonders willkommen sind dabei Nachwuchswissenschaftler*innen, die häufig an den Schnittstellen zwischen verschiedenen Zugängen und Traditionen arbeiten und daher wichtige Impulse für eine reflektierte und zukunftsgerichtete Musikwissenschaft liefern können.
Wir laden zu einem offenen, respektvollen und kollegialen Austausch ein, der Raum für unterschiedliche Standpunkte lässt und zur gemeinsamen Weiterentwicklung musikwissenschaftlicher Praxis beiträgt. In diesem Sinn freuen wir uns über themenaffine Beiträge von Wissenschaftler*innen und verschiedene analytische Perspektiven. Wir möchten insbesondere Frauen, BIPoC, Nachwuchswissenschaftler*innen, Personen aus dem Globalen Süden sowie Mitglieder unterrepräsentierter soziopolitischer Gruppen zur aktiven Teilnahme ermutigen.
RICHTLINIEN FÜR DIE EINREICHUNG VON ABSTRACTS
Einzelvorträge sollten zwischen 250 und 300 Wörter umfassen. Die Vortragsdauer beträgt 15 Minuten, die Diskussionszeit weitere 15 min.
Impulsvorträge (5 min.) für den Workshop sollten zwischen 150 und 200 Wörter umfassen.
EINREICHUNGSFRISTEN
Vorschläge und Abstracts sind bis spätestens 15. Oktober 2025 zu senden an koelnermusikgeschichten[at]hfmt-koeln[dot]de.
Jedes Abstract sollte Name und Vorname, eine kurze Biografie (100 Wörter), institutionelle Zugehörigkeit (falls zutreffend), E-Mail-Adresse und technische Anforderungen enthalten.
Das Programmkomitee wird die Vorschläge in einem PeerReview-Verfahren auswählen und die Teilnehmenden bis zum 31. Oktober 2025 über die Annahme informieren.
SPRACHE
Vorschläge und Beiträge können auf Deutsch oder Englisch eingereicht und vorgetragen werden. Die Vortragenden werden gebeten, zum Symposium eine englische Fassung ihres Vortrags bereitzustellen, um ein breiteres Verständnis zu ermöglichen.
PUBLIKATION
Eine Publikation ausgewählter Beiträge ist als konkretes Ergebnis des Symposiums geplant.
AUSRICHTENDE INSTITUTION
Das Symposium wird von der Hochschule für Musik und Tanz Köln veranstaltet. Das Lehrprojekt »Kölner Musikgeschichten. Postmigrantische Kulturen erforschen, vernetzen und verorten« ist Teil des Programms »Freiraum Lehre 2023« der Stiftung Innovation für Hochschullehre und wird geleitet von Prof. Dr. Sabine Meine.
KONTAKT
Organisatorische Leitung und Konzeption:
Dr. Juan Bermúdez (Gastprofessor HfMT Köln/Kunstuniversität Graz)
Assistent Prof. Dr. Erol Köymen (Florida State University)
Prof. Dr. Sabine Meine (HfMT Köln) gemeinsam mit Benjamin Bosbach, M.A. und Soudabeh Samiei, M.A. (beide HfMT Köln)
E-Mail-Adressen für Nachfragen: benjamin.bosbach[at]hfmt-koeln[dot]de; soudabeh.samiei[at]hfmt-koeln[dot]de